Beethoven. Wie oft habe ich mich als junge Frau mit ihm gelangweilt. Der Name war für mich ein Inbegriff für „hochtrabend“, „unlebendig“ und „anachronistisch“. Wenn ich in ein Konzert geriet, wurde mir die Zeit lang. Alles änderte sich, als ich einmal mehr in ein Konzert geriet, und in der Pause den Absprung verpasste. Ich hätte einen Berg Wäsche bügeln können, statt Beethoven zu hören. Ich ahnte ja was kommt. Und Sie oder Ihr ahnt, was wirklich kam: meine Bekehrung.
Vielleicht war ich deshalb so gespannt auf das aktuelle Beethoven-Buch von Martin Geck. Er hat nämlich Beethoven gleich aus der Perspektive mehrerer – wie er sie selbst nennt – „Größen aus Politik, Kunst und Wissenschaft“ dargestellt, statt selbst eine weitere Deutung zu schreiben. Ich dachte, vielleicht finde ich dort etwas über mein eigenes grobes Missverständnis, eine so innovative, lebendige Musik für ihr Gegenteil gehalten zu haben. Die gebotenen „Größen“ von Tintoretto zu Thomas Mann oder von Bach zu Glenn Gould zu Aldous Huxley versprachen ein kurzweiliges und vielfältiges Programm. -innen jedoch? Fehlanzeige, fast zumindest. Von 36 Stimmen sind nur vier weiblich. Das mag der Zeit geschuldet sein. Im 19. und auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts gibt es nicht viele Frauen, deren Äußerungen zu Beethoven überliefert sind. Dennoch hätte ich mich über eine Überraschung aus der Gegenwart gefreut, so wie ich mich über Gilles Deleuze gefreut habe: eine Stimme, die mir in Zusammenhang mit Beethoven nicht gerade auf dem Schirm flimmerte…
Ein schöner Vorteil dieser Idee der vielen Stimmen ist, dass sich die einzelnen Kapitel auch in nicht linearer Reihenfolge lesen lassen. Tatsächlich habe ich meine Lektüre mit dem letzten, dem Deleuze-Kapitel begonnen. Hier geht es gleich zu Anfang um den zweiten Satz von Beethovens Geistertrio op. 70,1, einem Stück, dem Deleuze in einem Fernsehspiel von Samuel Beckett begegnet. Notenbeispiele sucht man übrigens bei Geck vergeblich. Als Laie habe ich sie nicht vermisst und mir stattdessen Stücke, die ich nicht kannte, in einer oder mehreren youtube-Aufnahmen angehört. Beckett ist in diesem letzten Kapitel gleich der erste „O-Ton“, den Geck zitiert, darin Becketts Beobachtung, wie Pausen die Musik machen, und die daraus folgende Frage, wie man Sprache mit Pausen durchsetzen könne, die eine Art Durchschlüpfe für dahinter Liegendes bilden könnten. Deleuze wiederum begreift die von Beckett in seinem Stück nur fragmentarisch eingesetzte Musik des Geistertrios ihrerseits als „durchlöcherte Oberfläche“ und damit die Musik nicht mehr als möglicherweise Trost spendende von Beethovens Idealismus getragene Komposition, sondern als bloßes Aufflackern von Erinnerungen. Beethovens Musik, so zeigt sich für Beckett als auch für Deleuze, hat ein modernes Potential, das nicht in der herkömmlichen Deutung der Kompositionen liegt, sondern im Notenbild mit seinen Knotenpunkten, den Linien und eben den Pausen, den, wie Beckett schreibt „schwindelnden, unergründlichen Schlünden“ in der musikalischen Vorwärtsbewegung.
Deleuze kommt ferner auf die Idee, handgeschriebene Skizzen als eigenständige Äußerungen zu verstehen. Insofern, als hier Dinge notiert sind, die mit dem „fertigen“ Stück nicht unbedingt etwas oder viel gemein haben. Er schlägt also als eine Art Emanzipation der Skizze vom Werk vor, die eine neue Deutung von Skizzen und ihrer Eigenständigkeit – sagen wir als abstrakte musikalische Ideen jenseits eines Stücke-Zusammenhangs – ermöglichen. Aufregend, denke ich. Mir gefällt was ich lese. Doch der erste Satz des Kapitels macht mich stutzig: „Immer wieder vermögen Philosophen und Literaten erhellend über Musik zu schreiben, ohne über profunde musikalische Spezialkenntnisse zu verfügen.“ Das passt so gar nicht zu dem, was ich mir erhoffte: eine nach allen Seiten hin offene Deutung von oder Annäherung an Musik. – Fortsetzung folgt…
Martin Geck, Beethoven und sein Universum, München 2017.
Ich danke Random-House für das Rezensionsexemplar.

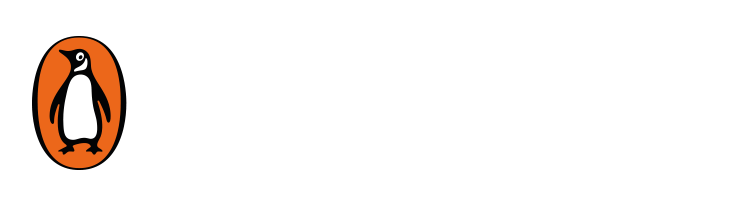
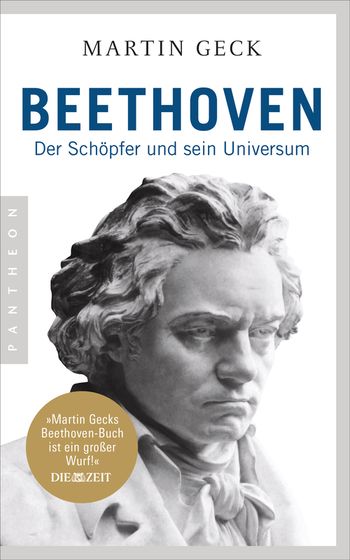

Leserstimmen Das sagen andere LeserInnen
Von: Alexandra Antipa
Von: Connies Schreibblogg
Von: Stephanie Jaeckel
Von: Roland R. Ropers - Kultur- & Sprachphilosoph
Von: Michael Lehmann-Pape